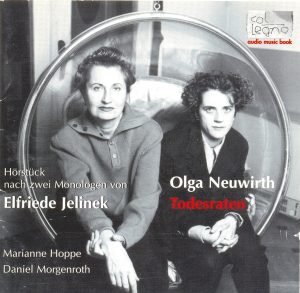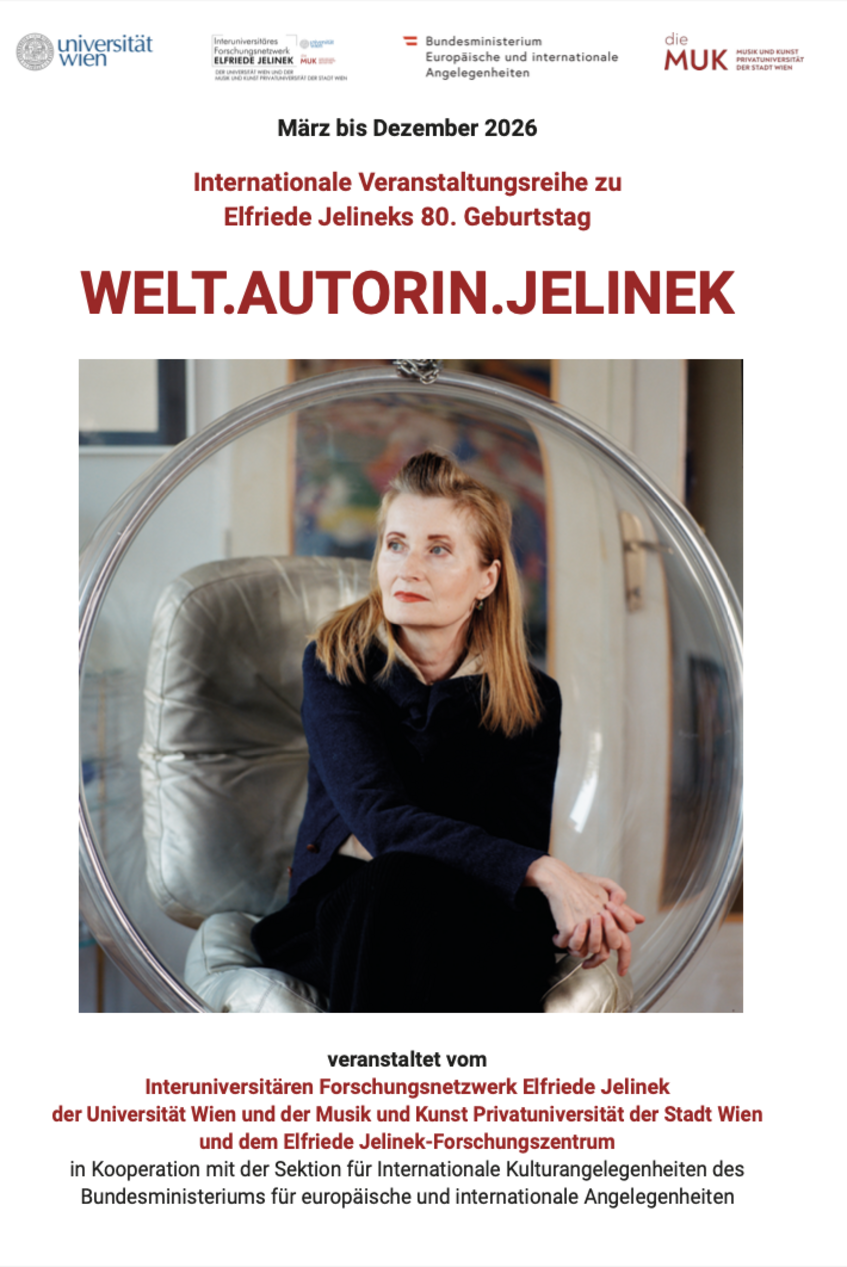Für Jelineks Werke ist der Umgang mit unterschiedlichen Gattungen und Medien charakteristisch. Die Autorin arbeitet nicht nur mit Sprache, sondern mit allen Kunstformen wie Musik, Theater, Tanz, Film / Video, bildende Kunst, Mode, Installation und Medienkunst. Sie überschreitet, vernetzt und transformiert diese Formen zu komplexen intermedialen Texturen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch ihre Zusammenarbeit mit VertreterInnen anderer Kunstformen sowie die intermediale Umsetzung ihrer Theatertexte durch KünstlerInnen wie Ulrike Ottinger, Einar Schleef oder Christoph Schlingensief.
Das Elfriede Jelinek-Forschungszentrum befasst sich seit seiner Gründung mit diesen intermedialen Formen und Zusammenarbeiten. So dokumentiert das 2004 erschienene Werkverzeichnis Elfriede Jelinek erstmals alle intermedialen Arbeiten Jelineks sowie alle künstlerischen Bearbeitungen ihrer Werke.
Das Symposium zu Jelineks 60. Geburtstag war den intermedialen Überschreitungen insbesondere in den Bereichen Theater, Musik, Hörspiel, Film und bildende Kunst gewidmet. Die Zusammenarbeit mit KünstlerInnen wie Olga Neuwirth, VALIE EXPORT, Ulrike Ottinger, Bernd R. Bienert, Hans Scheugl, Christoph Schlingensief und Elke Krystufek standen dabei zur Diskussion.
Im April 2011 fand unter dem Titel „Der Gesamtkünstler. Christoph Schlingensief“ ein großangelegter Schwerpunkt zu Christoph Schlingensief statt, bei dem sein künstlerischer Anspruch und die Form seiner theatralen Arbeiten diskutiert wurden.
Im März 2012 widmete sich das Symposium „(ach, Stimme!). VALIE EXPORT, ELFRIEDE JELINEK, OLGA NEUWIRTH“ den Bezügen und Zusammenarbeiten der drei österreichischen Künstlerinnen. Das Symposium wurde vom gleichnamigen Interdisziplinären Wissenschaftsportal begleitet.
Das Symposium „‚Sinn egal. Körper zwecklos‘. Postdramatik – Reflexion und Revision“ im Mai 2014 befasste sich, ausgehend von Jelineks Theatertexten, mit einer grundlegenden Befragung des Begriffs und Themenfeldes „Postdramatik“ und in diesem Zusammenhang auch mit intermedialen Aspekten.
Unter dem Titel „Kunst und Politik“ wurden im November 2019 im Rahmen eines interdisziplinären Symposiums verschiedene Künste (wie Literatur, Musik, Theater, Tanz, bildende Kunst, Film) und neue intermediale künstlerische Formate in Hinblick auf ihre politisch-ästhetischen Möglichkeiten untersucht. Das Symposium befasste sich mit grundsätzlichen Aspekten politischer Ästhetik: Was ist „politische Kunst“? Wie könnte/sollte Kunst „politisch“ sein? Ausgehend von politisch-ästhetischen Verfahren, wie sie etwa Elfriede Jelineks Werk charakterisieren, wurden auch konkrete Formen und Strategien zeitgenössischer politischer Kunst diskutiert.
Die Veranstaltungsreihe „Text.Notation.Performance – Interdisziplinäre Perspektiven“, die im Juni 2021 als Begleitprogramm zur gleichnamigen Ringvorlesung im Sommersemester 2021 stattfand, widmete sich, ausgehend von aktuellen Forschungspositionen zur Materialität von „Text”, „Notation” und „Werk”, dem Spannungsfeld von Notation und Improvisation, Werk und Inszenierung in den verschiedenen Künsten (Literatur, Musik, Theater, Performance, Oper, bildende Kunst) an den Schnittstellen von Wissenschaft und Kunst.
Im Rahmen des größeren Schwerpunktes des Forschungszentrums zu „Elfriede Jelinek und die Musik“ konnten bisher mehrere Veranstaltungen realisiert werden.
So widmete sich ein Termin der Veranstaltungsreihe „Elfriede Jelinek – Nestbeschmutzerin & Nobelpreisträgerin“ den musikalischen Prägungen und Bezügen der Autorin. Im Rahmen von Vorträgen und Gesprächen wurden u.a. das kompositorische Denken Elfriede Jelineks, ihr Bezug zur Musik und ihre musikalische Herkunft diskutiert.
Das Symposium „‚die nichtsgewisseste Musik, die ich kenne‘“, das im März 2017 stattfand, rückte in Form von Kurzvorträgen und Gesprächen die vielfältigen Bezüge Elfriede Jelineks zu ihrem Lieblingskomponisten Franz Schubert ins Zentrum. Musikausschnitte und Lesungen gaben Einblicke in die Auseinandersetzung.
Das Symposium „‚Das Lachen ist der Ausnahmezustand‘“ befasste sich im November 2017 mit dem Spannungsfeld von Musiktheater und subversiver Komik. Ausgehend von Elfriede Jelineks Bezügen zur Musik ging es dabei insbesondere um Musiktheater in Österreich seit den 1960er Jahren.
Das Thema des Symposiums „MUSIK.THEATER. Die Oper als Aufführung“, das im November 2019 abgehalten wurde, war die Oper als szenische Herausforderung. Die performative Dimension von Musiktheater und das Spannungsfeld von Werk und Aufführung, von Partitur und Inszenierung standen im Zentrum der Vorträge und Gespräche. Unterschiedliche Ansätze wie die Rekonstruktion historischer Aufführungspraxis sowie neue szenische Formen, die frei mit dem Material umgehen, wurden diskutiert.
Das Symposium „LIBRETTO. Zukunftswerkstatt Musiktheater“, das im Mai 2019 stattfand, befasste sich mit dem Libretto im zeitgenössischen Musiktheater. Die Frage, was heute ein „gutes“ Libretto ausmacht, stand im Zentrum der Vorträge und Gespräche mit renommierten Komponist*innen, Librettist*innen, Theaterleuten und Wissenschaftler*innen. Ausgehend vom Stellenwert, den der Text aktuell im Musiktheater hat, wurden Visionen für Zukünftiges entwickelt und neue Gestaltungsformen angedacht.
Das Symposium „WORT.MUSIK. Zur Musikalisierung von Literatur“ befasste sich im Juni 2022 mit experimentellen Formen und transmedialen Verfahren der Musikalisierung von Literatur. Ausgehend von Jelineks musikalischen Schreibverfahren, der besonderen Klanglichkeit und Rhythmik ihrer Texte und der Übernahme musikalischer Kompositionsprinzipien wurde den Künste-übergreifenden Bezügen und Symbiosen zwischen Literatur und Musik nachgespürt, wie sie insbesondere in der österreichischen Literatur bis in die Gegenwart zu finden sind.
Ausgehend von der in Jelineks Texten bereits angelegten Klanglichkeit wurde im Rahmen des Symposiums „TEXT – SPRECHEN – SINGEN. Klanglichkeit in Literatur und (Musik-)Theater“ im März 2023 nach dem bedeutungsmodifizierenden Charakter von Praktiken des Text-Sprechens bzw. Text-Singens gefragt, nach der Theatralität der Stimme und der Performativität des Schweigens – sowie nach unterschiedlichen Traditionen und Praktiken des interpretierenden Sprechens, der Stimmführung und des Gesangs im Theater und im Musiktheater.
Die letztgenannten Veranstaltungen sind Teil des 2024 gestarteten Forschungsschwerpunkts „Musik.Theater“, der seinen Ausgangspunkt beim musikalischen Potenzial von Elfriede Jelineks (Theater-)Texten, ihrer Arbeit mit dem Klang und der Lautlichkeit von Sprache und dem besonderen Fokus, den die Autorin auf die Musikalität ihrer Texte legt, nimmt. Jelinek schrieb nicht nur selbst Libretti für die musiktheatralen Werke anderer Künstler*innen, sie schafft zudem in ihren Theatertexten konsequent musikalische Strukturen, u.a. durch die Arbeit mit polyphonen Textflächen und der Rhythmisierung des Textmaterials im Chorischen. Diese Aspekte werden im Rahmen von Gesprächen, Workshops und Veranstaltungen aufgegriffen, thematisiert und diskutiert.